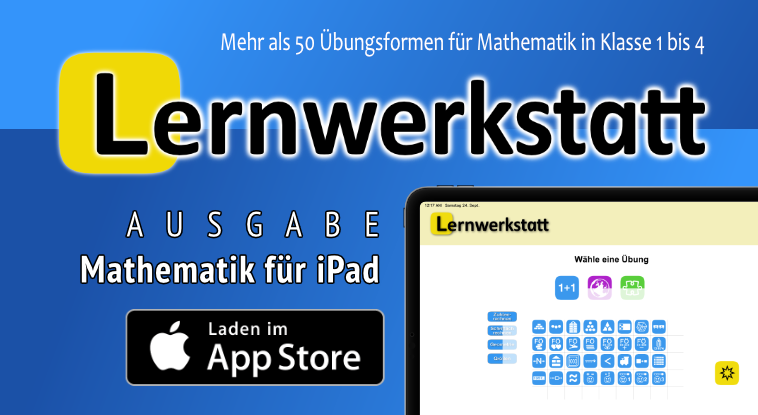|
Ab dem 14. Jahrhundert begann sich dann das Metallhorn vor allem bei der Jagd und beim Militär durchzusetzen. Im Gegensatz zu den heutigen Hörnern war es mit diesen Hörnern allerdings nicht möglich alle Töne zu spielen. Wechselte die Tonart , wurde die Stimmung durch den Einbau oder die Herausnahme von Aufsatzbögen und Setzstücken, d.h. durch Verlängerung oder Verkürzung des Instruments, verändert. Eine andere Möglichkeit der Tonveränderung war bis zur Erfindung der Ventile das sogenannte „Stopfen“. Durch Einführen der Hand in den Schallbecher war es dem Musiker möglich den Ton in seiner Höhe zu verändern; der gestopfte Ton klingt allerdings im Vergleich zu den offen geblasenen Tönen bedeutend glanzloser und metallischer. Diese Technik war mit Einführung der Ventile praktisch überflüssig, kommt aber heute gelegentlich noch als besonderer Effekt zum Einsatz. Nach Einführung der Ventile, um 1820 durch H. Stölzel und F. Blühmel, nahm das Horn recht schnell einen festen Platz im Orchester ein und ist dort heute 3- bis 8-fach vertreten. |
|
Durch sein kreisrund gewundenes Rohr ist das Horn nicht sofort als eines der längsten Blasinstrumente zu erkennen. Würde man z.B. das B-Horn „abwickeln“, hätte es die stattliche Länge von 2,90 m – das F-Horn wäre sogar 3,60 m lang. Nur die B-Tuba ist mit 5,50 m länger als das Horn! Das weitgehend zylindrische, enge Rohr weitet sich an seinem Ende dann zu einem weitausladenden Schallbecher (30 cm).
|
|
Das Hornspiel erfordert jedoch eine hohe Lippen- und Zungentechnik, da das Mundstück einen relativ geringen Durchmesser hat und die Töne sehr schwer zu treffen sind. Insgesamt liegen die Töne sehr nahe beieinander. Daher gilt das Horn neben der Oboe als eines der am schwierigsten zu spielenden Instrumente.
|
|
|
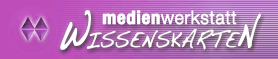 |
Kategorie: ![]() Alle
Alle ![]() Kunst, Musik und Sport
Kunst, Musik und Sport ![]() Musik
Musik ![]() Musikinstrumente
Musikinstrumente
Horn |
 Vorläufer des heutigen Horns (Waldhorn) sind schon seit Urzeiten bekannt. Die Verwendung der aus Tierhorn, Leder oder Holz bestehenden Instrumente beschränkte sich aber nur auf den Gebrauch als Signalinstrument.
Vorläufer des heutigen Horns (Waldhorn) sind schon seit Urzeiten bekannt. Die Verwendung der aus Tierhorn, Leder oder Holz bestehenden Instrumente beschränkte sich aber nur auf den Gebrauch als Signalinstrument. Das moderne Horn besitzt 3 Ventile und wird in den
Stimmungen F, B oder Es gebaut. F- und B-Horn sind
in dem häufig anzutreffenden Doppelhorn vereint, bei dem durch die Betätigung eines Ventils zwischen den beiden Stimmungen gewechselt werden kann.
Das moderne Horn besitzt 3 Ventile und wird in den
Stimmungen F, B oder Es gebaut. F- und B-Horn sind
in dem häufig anzutreffenden Doppelhorn vereint, bei dem durch die Betätigung eines Ventils zwischen den beiden Stimmungen gewechselt werden kann.
 Der Klang des Horns, das einen sehr grossen Tonumfang hat, ist ausserordentlich vielseitig; er reicht von weichem piano (leise) bis zu scharfem fortissimo (sehr laut), mischt sich aber sowohl mit Holz- als auch mit den anderen Blechblasinstrumenten gut.
Der Klang des Horns, das einen sehr grossen Tonumfang hat, ist ausserordentlich vielseitig; er reicht von weichem piano (leise) bis zu scharfem fortissimo (sehr laut), mischt sich aber sowohl mit Holz- als auch mit den anderen Blechblasinstrumenten gut.